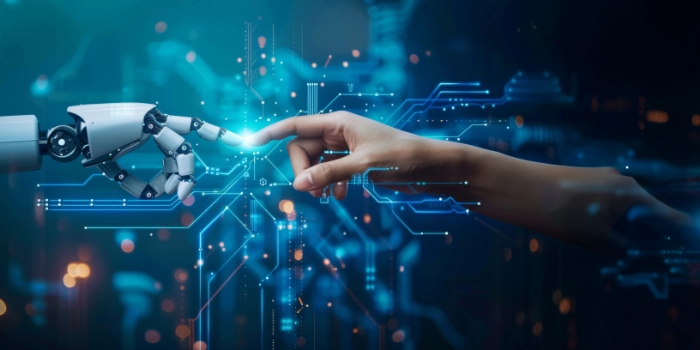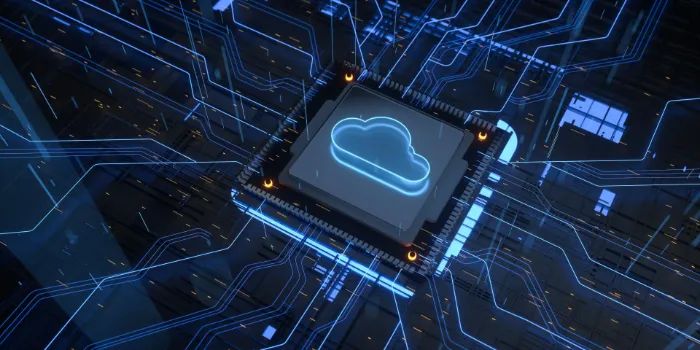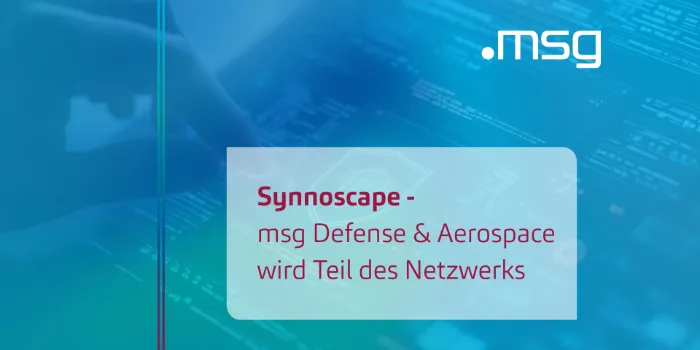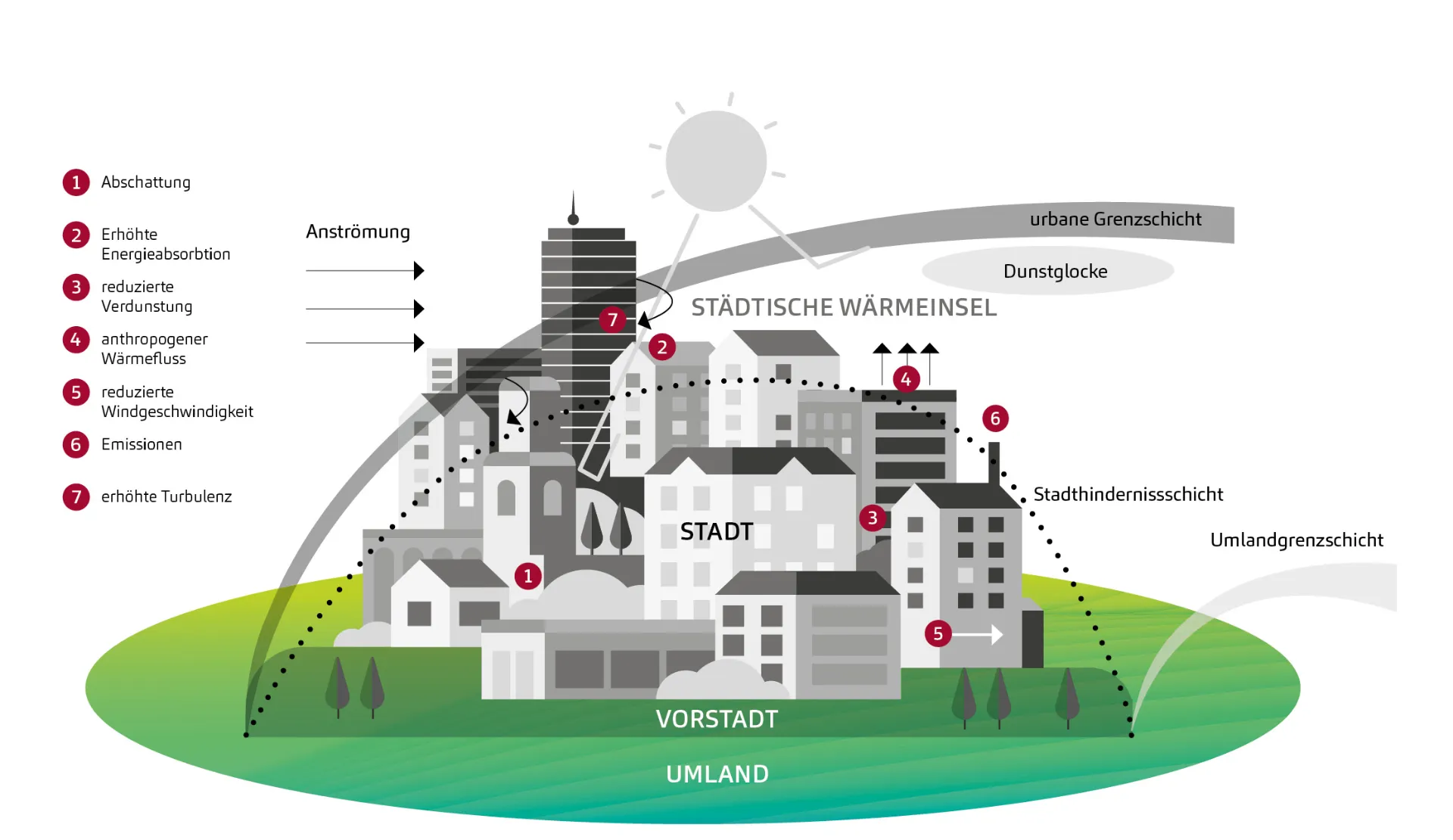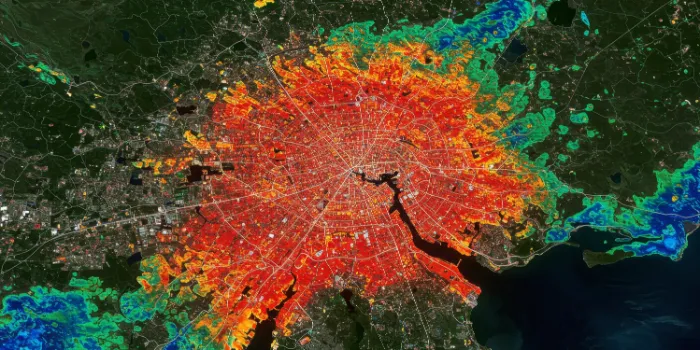msg Public Sector beim
4. ZuKo Sozialversicherungen | 2025
msg Public Sector ist Partner des 4. ZuKo Sozialversicherungen – mit eigenem Messestand und Best-Practice-Dialog zeigen wir vor Ort, wie Künstliche Intelligenz die Sozialverwaltung bereits heute spürbar entlasten kann. Kommen Sie vorbei!
msg events
Europäischer Polizeikongress 2025
Am 20. und 21. Mai findet in Berlin der Europäische Polizeikongress statt – die führende internationale Plattform für politische und polizeiliche Entscheidungsträger. Rund 1.900 Expertinnen und Experten aus über 20 Ländern kommen zusammen.
msg events
Vom 15. bis 17. Oktober 2024 findet die diesjährige Smart Country Convention im hub27 auf dem Messegelände Berlin statt. Auch in diesem Jahr freuen wir uns, Sie an unserem Stand Nr. 318 auf der #SCCON begrüßen zu dürfen.
Produkt
From Data to Value: Erschließen Sie Mit Data Excellence verborgenes Wissen und treffen Sie bessere Entscheidungen für das Unternehmen.
Produkt
Profitabilitäts- und Kostenanalyse in Hochgeschwindigkeit.
msg publikation
Explodierende Preise für Strom und Gas stellen Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Energieversorger gleichermaßen vor Herausforderungen. Den Stadtwerken als zentralen Akteuren im lokalen Ökosystem kommt in dieser Situation eine besondere Rolle zu. Kommunale Energiesparwelten liefern ihnen die geeignete Plattform, um Partner vor Ort zusammenzubringen und mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern in einen aktiven Dialog zum Energiesparen zu treten.
msg publikation
Wir schauen mit Entscheiderinnen und Entscheidern aus der Politik auf Digitalisierungs-Highlights 2023 und wo es 2024 hingehen soll.
msg publikation
Manchmal wird man als österreichischer Vertreter von den deutschen Kolleginnen und Kollegen angesprochen: Was läuft anders in eurem E-Government?