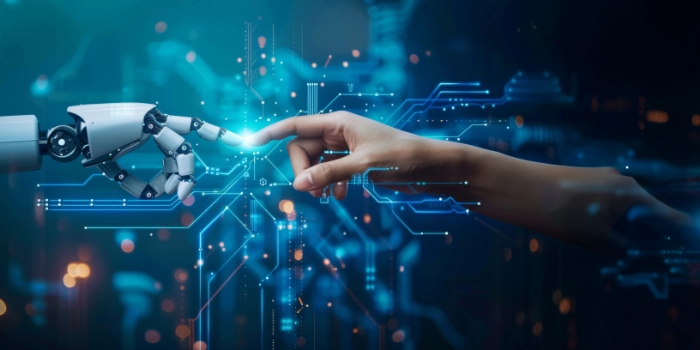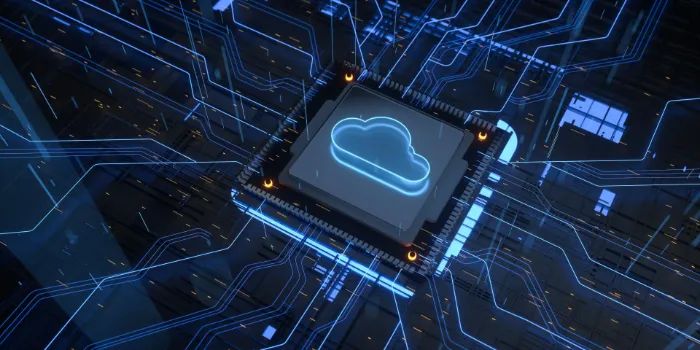Komplex, teuer, uneinheitlich – Warum der
föderale Sozialstaat KI braucht
Komplexität beherrschen: Wie KI den föderalen Sozialstaat entlastet
Ob Bürgergeld, Jugendhilfe oder Pflegeleistungen – das Sozialgesetzbuch (SGB) bildet das Rückgrat des deutschen Sozialstaats. Doch seine Umsetzung ist komplex, teuer und oft unklar geregelt. Das Sozialgesetzbuch ist das zentrale Regelwerk des deutschen Sozialstaats. Es formuliert bundesweit gültige Ansprüche auf soziale Leistungen in Bereichen wie Arbeitsförderung, Grundsicherung, Kranken- und Pflegeversicherung, Teilhabe und Rentenversicherung1. In der Praxis jedoch zeigt sich ein anderes Bild: Die föderale Struktur Deutschlands erschwert eine gleichmäßige Umsetzung dieser Leistungen erheblich. Denn obwohl der Bund für die Gesetzgebung zuständig ist, wird die praktische Durchführung durch die Länder und Kommunen verantwortet – mit weitreichenden Folgen für Gleichheit, Effizienz und Rechtsklarheit.
Insbesondere dort, wo die Umsetzung des SGB von mehreren Behörden auf verschiedenen föderalen Ebenen abhängt, entstehen strukturelle Reibungsverluste. Diese sogenannte Verwaltungsverflechtung ist nicht nur ein technisches Problem, sondern stellt auch eine zentrale Herausforderung für die Wirksamkeit des Sozialstaats dar2. Die verschiedenen Ebenen – Bund, Länder und Kommunen – müssen jeweils eigene Verwaltungsverfahren, IT-Strukturen und Zuständigkeitsbereiche koordinieren, obwohl sie häufig gemeinsam an einem Fall arbeiten. Typische Beispiele dafür sind Leistungen nach dem SGB II („Bürgergeld“) oder dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), bei denen sowohl Bundesbehörden (z.B. die Bundesagentur für Arbeit) als auch Kommunen, Sozialämter oder freie Träger beteiligt sind.
Ergänzend zur Sozialgesetzgebung kommen zahlreiche weitere länderspezifische Gesetze und Verordnungen hinzu, die von den beteiligten Ämtern ebenfalls beachtet werden müssen. Diese spezifischen Gesetze ergänzen und präzisieren die SGB-Regelungen für bestimmte Leistungsbereiche und erhöhen dadurch die Komplexität der Sozialgesetzgebung weiter.
Damit ergibt sich für Ämter, Behörden und Träger eine Vielzahl von rechtlichen Vorgaben, die verwoben sind und deren Einhaltung eine immense Herausforderung für die Verwaltung darstellt. Die Folge sind uneinheitliche Entscheidungen, Verzögerungen, Informationsverluste und eine insgesamt schwer durchschaubare Verwaltungspraxis.
Ineffizienzen und finanzielle Folgen des föderalen Systems
Ein oft unterschätzter Aspekt föderaler Fragmentierung im SGB-Vollzug sind die damit verbundenen hohen finanziellen Kosten. Allein die Verwaltungskosten für die Grundsicherung (SGB II/“Bürgergeld“) lagen 2023 bei 7,418 Milliarden Euro – das entspricht etwa 1.888 Euro pro leistungsberechtigter Person. Und diese Kosten steigen weiter an3. Die Verteilung der operativen Mittel in den Jobcentern verdeutlicht das grundlegende Problem: Wie die Einrichtungen die zugewiesenen Gelder zwischen Verwaltung und Arbeitsförderung aufteilen, bleibt ihnen selbst überlassen. Während immer mehr Geld in die Verwaltung fließt, stagniert das Budget für die aktive Hilfe zur Arbeitsmarktintegration.
Diese Entwicklung bestätigt auch eine Analyse der Bertelsmann Stiftung: Im Jahr 2024 standen den Jobcentern insgesamt etwa 10,7 Milliarden Euro für Verwaltung und arbeitsmarktbezogene Maßnahmen zur Verfügung. Davon entfielen rund 6,5 Milliarden Euro auf Verwaltungskosten, während lediglich etwa 3,8 Milliarden Euro für konkrete Fördermaßnahmen wie Trainings, Fortbildungen und Umschulungen eingesetzt wurden4. Das bedeutet: Über 60 Prozent der den Jobcentern verfügbaren operativen Mittel entfallen auf Verwaltungsaufgaben – nicht auf direkte Hilfe zur Arbeitsmarktintegration.
Wenn Behörden mehrfach prüfen, widersprüchliche Bescheide ausstellen oder Rückforderungen einleiten müssen, entstehen vermeidbare Zusatzkosten in Form von Personalzeit, Gerichtsverfahren oder Revisionsprüfungen. Solche Ineffizienzen resultieren häufig aus föderal zersplitterten Zuständigkeiten und dem Fehlen durchgängiger digitaler Werkzeuge zur Fallbearbeitung und Datenintegration. Ein effizienter, koordinierter Vollzug wäre nicht nur gerechter, sondern auch wirtschaftlich dringend geboten.
Förderale Integrationspolitik – Sozialrechtliche Ungleichheit am Beispiel Migration
Diese Probleme sind auch sichtbar im Bereich der Migrations- und Integrationspolitik, die in den letzten Jahren mehrfach reformiert wurde – etwa mit Blick auf die Fachkräfteeinwanderung, auf die Arbeitsmarktintegration Geflüchteter oder auf das Staatsangehörigkeitsrecht5. Alle drei Bereiche berühren unmittelbar das Sozialrecht, insbesondere das SGB II, SGB III, SGB VIII und SGB XII. Zusätzlich gibt es weitere wichtige Regelungen über das Sozialgesetzbuch hinaus, die die Unterstützung und Integration von Migrantinnen, Migranten und Geflüchteten regeln. Die praktische Umsetzung dieser Gesetze und Regelungen, besonders der Sozialgesetzbücher, wird maßgeblich durch die Komplexität der föderalen Verwaltungsstruktur geprägt. So ist etwa die Bearbeitung von Aufenthaltstiteln oder Visa mit zahlreichen behördlichen Abhängigkeiten verbunden: Ausländerbehörden, Bundesagentur für Arbeit, BAMF und lokale Beratungsstellen müssen zusammenarbeiten, oft ohne gemeinsame Standards oder digitale Schnittstellen. Die Behörden vor Ort sind mit diesen Anforderungen häufig überfordert – nicht nur wegen fehlender Ressourcen, sondern auch, weil es keine klar definierte Gesamtverantwortung gibt und der Überblick über die rechtlichen Anforderungen fehlt. Eine Antragstellerin muss oft dieselben Unterlagen mehrfach einreichen, weil die beteiligten Behörden nicht zentral auf Dokumente zugreifen können. Trotz Onlinezugangsgesetz (OZG) bestehen noch immer viele medienbruchhafte Prozesse, die eine effektive Bearbeitung verhindern.
Ein besonders deutliches Beispiel ist die sogenannte Job-Turbo-Initiative, die Geflüchtete schneller in den Arbeitsmarkt integrieren soll6. Das Programm sieht vor, dass Geflüchtete zügig – auch ohne umfassende Sprachkenntnisse – in einfache Beschäftigungen vermittelt werden, um erste berufliche Erfahrungen zu sammeln. Dabei wird die bisherige Logik „Sprache zuerst, dann Arbeit“ durchbrochen. Die konkrete Umsetzung aber ist je nach Bundesland, Kommune oder sogar einzelner Ausländerbehörde sehr unterschiedlich. Während einige Jobcenter eng mit Sprachkursträgern kooperieren und flexible Teilzeitangebote entwickeln, berichten andere Regionen von fehlender Abstimmung und Verunsicherung unter den Sachbearbeitenden. Ein einheitliches Verständnis darüber, wie Integration und Erwerbsförderung gleichzeitig ablaufen sollen, fehlt. Auch zentrale Datensysteme wie das Ausländerzentralregister (AZR), das als Basis für viele Verfahren dient, werden von Behörden unterschiedlich genutzt oder misstrauisch beurteilt – teilweise, weil Schulungen fehlen, teilweise wegen technischer Hürden.
Ähnlich zeigt sich das Problem beim Chancen-Aufenthaltsrecht, das langjährig Geduldeten eine Bleibeperspektive durch Integration bieten soll. Auch hier hängen Entscheidungen über die Aufenthaltserlaubnis davon ab, ob bestimmte soziale Leistungen bezogen wurden oder nicht – was wiederum durch SGB-Leistungen wie Grundsicherung, Wohngeld oder Förderung über Integrationsmaßnahmen beeinflusst wird. Ob eine Person also als „integriert“ gilt, wird unterschiedlich bewertet, weil die Datenlage fragmentiert ist und es kein bundesweit einheitliches Verfahren zur Bewertung gibt. Die praktische Folge: Personen mit vergleichbarer Biografie und Lebenslage erhalten in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Bescheide.
Ein drittes Beispiel betrifft die Einbürgerung, deren Verfahren nach der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts ab 2024 beschleunigt und vereinfacht werden sollte7. Die Zielsetzung – mehr Teilhabe durch erleichterte Einbürgerung – ist politisch gewollt. Doch die tatsächliche Umsetzung ist von den jeweiligen Landesgesetzen, kommunalen Zuständigkeiten und organisatorischen Möglichkeiten abhängig. Viele Einbürgerungsbehörden arbeiten am Limit, weil das Personal fehlt oder digitale Antragssysteme nicht vorhanden sind. In der Konsequenz entstehen Rückstaus, lange Wartezeiten und regionale Unterschiede im Zugang zum deutschen Pass.
Flickenteppich sozialer Rechte
Die Beispiele zeigen, dass die Umsetzung sozialrechtlich relevanter Gesetze in Deutschland nicht allein von rechtlicher Klarheit abhängt. Vielmehr ist es die Struktur des föderalen Systems in Kombination mit dem Fachkräftemangel und optimierbarer Verwaltungspraxis selbst, die eine einheitliche, transparente und gerechte Anwendung erschwert. Dabei geht es nicht nur um Effizienz – sondern um die grundsätzliche Frage, ob gesetzlich zugesicherte soziale Rechte in der Realität tatsächlich überall gleichermaßen gelten.
In der politischen Debatte wird dieser Umsetzungsrückstand zunehmend als Legitimationsproblem des Sozialstaats diskutiert. Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht, dass Gesetze nicht nur erlassen, sondern auch verlässlich vollzogen werden. Wenn aber Sozialleistungen – etwa Integrationsmaßnahmen oder aufenthaltsrechtliche Verfahren – von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich handhabbar sind, entsteht ein Flickenteppich sozialer Rechte. Diese Ungleichheit schwächt das Vertrauen in staatliches Handeln und unterminiert das Ziel, gleiche Lebensverhältnisse in allen Teilen der Republik herzustellen. Darüber hinaus erschwert die föderale Interessenlage Reformprozesse erheblich: Selbst bei einheitlichem Problembewusstsein verhindern divergierende politische Zielsetzungen zwischen Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden häufig strukturelle Veränderungen im Vollzug sozialrechtlicher Normen8.
Das Problem liegt also nicht in der Gesetzgebung selbst, sondern in der Struktur und Organisation ihrer Ausführung. Solange diese nicht abgestimmt, digital integriert und zuständigkeitsklar geregelt ist, bleibt der Sozialstaat trotz guter gesetzlicher Grundlagen in vielen Bereichen fragmentiert.
KI – Lösung für das Föderalismusdilemma im Sozialrecht?
Digitale Technologien und insbesondere Künstliche Intelligenz (KI) bieten in diesem Zusammenhang vielversprechende Perspektiven, um die strukturellen Schwächen des föderalen Sozialstaats zu adressieren. KI-gestützte Systeme können Routineaufgaben automatisieren, Schnittstellen zwischen Behörden transparenter machen und die Anwendung komplexer Regelwerke wie des SGB und seiner ergänzenden „Spezialgesetze“ systematisch unterstützen.
Die Kombination aus modernen digitalen Technologien und KI hat das Potenzial, das föderale Dilemma des Sozialstaats erheblich zu entschärfen, indem sie Verwaltungsprozesse verschlankt, Transparenz erhöht und den Zugang zu Sozialleistungen gerechter gestaltet. Voraussetzung dafür ist jedoch ein Kulturwandel in der Verwaltung, bessere rechtliche Rahmenbedingungen und der konsequente Ausbau digitaler Infrastruktur und die Nutzung geeigneter Tools. Nur so kann der Sozialstaat im föderalen Gefüge effizient, bürgernah und inklusiv funktionieren.
Erst wenn eine KI in der Lage ist, das komplexe Geflecht an Gesetzen, Verordnungen und föderalen Regelungen zielgruppengerecht aufzubereiten, ist eine wirkungsvolle Unterstützung sowohl der Sachbearbeitenden als auch der Bürgerinnen und Bürger möglich. Diese Anforderung erfüllt das KI-System msg.CodIQ aus dem Hause msg vollständig. Es ist speziell darauf ausgelegt, die komplexe Landschaft der Gesetze und Verordnungen in der Sozialgesetzgebung und darüber hinaus verständlich aufzubereiten. Sie strukturiert und visualisiert die Rechtslage übersichtlich, bietet passgenaue Handlungsempfehlungen und erleichtert damit die schnelle, einheitliche und nachvollziehbare Entscheidungspraxis. Damit wird nicht nur die Qualität und Effizienz der Verwaltung verbessert, sondern auch der Zugang zu Sozialleistungen spürbar vereinfacht.
Gerade im Kontext der Migrations- und Integrationspolitik können solche spezialisierten KI-Lösungen helfen, die föderale Fragmentierung und die Vielfalt der rechtlichen Vorgaben besser zu überblicken – von Aufenthaltstiteln über Integrationsmaßnahmen bis hin zur sozialen Unterstützung – und dadurch die Verwaltung sowie Antragstellende nachhaltig zu entlasten.
1Sozialgesetzbuch (SGB), https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/
2SVR, Jahresgutachten 2025 – Reformen, die wirken? Die Umsetzung von aktuellen Migrations- und Integrationsgesetzen, Berlin 2025, https://www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2025/06/Jahresgutachten-2025_barrierefrei.pdf
3Bremer Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (Kurzmitteilungen), https://biaj.de/archiv-kurzmitteilungen/1916-hartz-iv-sgb-ii-verwaltungskosten-stiegen-2023-auf-7-4-milliarden-euro-rueckblick-bis-2012-bzw-2005.html?utm_source=chatgpt.com
4Bertelsmann Stiftung, Bürgergeld: Anspruch Realität und Zukunft, Gütersloh 2025, https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/themen/aktuelle-meldungen/2025/maerz/buergergeld-mehr-fordern-besser-foerdern-verwaltung-reformieren#:~:text=In%20den%20vergangenen%20zehn%20Jahren,dieser%20Gelder%20in%20die%20Verwaltung.
5SVR, Jahresgutachten 2025 – Reformen, die wirken? Die Umsetzung von aktuellen Migrations- und Integrationsgesetzen, Berlin 2025, https://www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2025/06/Jahresgutachten-2025_barrierefrei.pdf
6SVR, Jahresgutachten 2025 – Reformen, die wirken? Die Umsetzung von aktuellen Migrations- und Integrationsgesetzen, Berlin 2025, https://www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2025/06/Jahresgutachten-2025_barrierefrei.pdf
7SVR, Jahresgutachten 2025 – Reformen, die wirken? Die Umsetzung von aktuellen Migrations- und Integrationsgesetzen, Berlin 2025, https://www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2025/06/Jahresgutachten-2025_barrierefrei.pdf
8PVS, Verwaltungsverflechtungen im föderalen System, Politische Vierteljahresschrift 65, Berlin 2024, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11615-023-00525-8.pdf
Autor
Richard Pielczyk ist Abteilungsleiter bei msg und engagiert sich mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem fundierten Methodenwissen für die Modernisierung der Sozialwirtschaft. Gemeinsam mit seinem Team begleitet er soziale Einrichtungen und Verwaltungen bei der Entwicklung und Umsetzung tragfähiger Digitalisierungsstrategien und -lösungen, um deren Arbeitsalltag zu entlasten und nachhaltig zu verbessern.