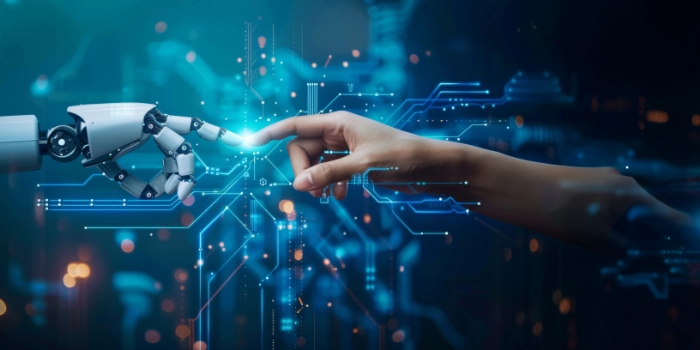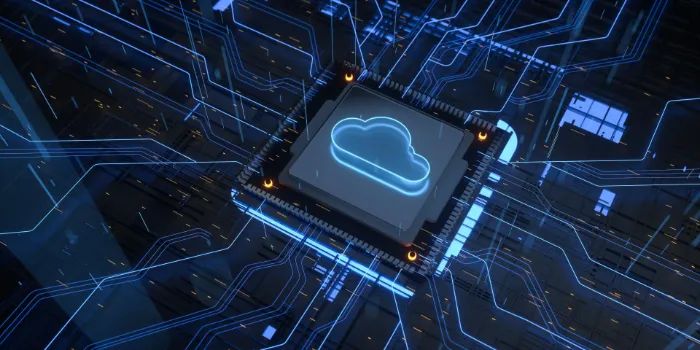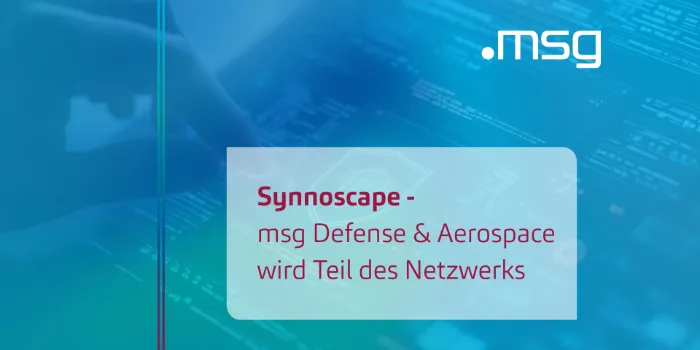„The Road to Automated Democracy“
Demokratiekompatible Digitalisierung
Interview mit Dr. Christian R. Ulbrich
Effizienz, Transparenz & Kontrolle: zwischen technischen Möglichkeiten und politischen Herausforderungen
Die Digitalisierung verspricht Effizienz, Komfort und schnellere Entscheidungen – auch im staatlichen Kontext. Doch was bedeutet es für unsere demokratischen Strukturen, wenn auf Basis großer Datenmengen zunehmend menschliche Entscheidungen und Tätigkeiten digital automatisiert werden?
Dr. Christian R. Ulbrich leitet die Forschungsstelle für Digitalisierung in Staat und Verwaltung (e-PIAF) an der juristischen Fakultät der Universität Basel.
In der Studienserie Road to Automated Democracy1 untersucht er, wie digitale Dynamiken zunehmend auch den öffentlichen Sektor prägen. In der ersten Ausgabe des Monitors demokratiekompatible Digitalisierung nimmt er das staatsorganisatorische Innenverhältnis unter die die Lupe und vergleicht die Entwicklungen in der Schweiz, Deutschland, Estland und dem Vereinigten Königreich miteinander. Im ersten Teil des Interviews mit Dr. Christian R. Ulbrich diskutieren wir über Zentralisierungstendenzen und weshalb Wettbewerb sowie dezentrale Vielfalt auch im digitalen Staatskontext entscheidend bleiben.
Das Interview führte Werner Achtert, Executive Business Consultant im Geschäftsbereich Public Sector der msg.
Ihr Ansprechpartner

Werner Achtert: Digitalisierung hat Einfluss auf viele Lebensbereiche. In der Studie Road to Automated Democracy haben Sie eine Reihe digitaler Dynamiken identifiziert, die demokratischen Strukturen entgegenwirken können. Wodurch entstehen diese Dynamiken?
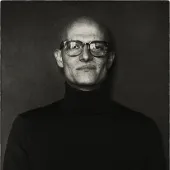
Dr. Christian Ulbrich
Zunächst einmal ist es spannend, dass sich keiner fragt, was Digitalisierung eigentlich konkret bedeutet. Wenn man jemanden auf der Straße oder in der Verwaltung darauf anspricht, dann gehen alle davon aus, dass das, was derzeit im Analogen vorhanden ist, einfach eins zu eins ins Digitale übersetzt wird: Ich habe eine behördliche Auskunft, dann wird diese durch einen Chatbot ersetzt oder ein Formular wird schlicht zu einem Online-Formular.
In dem Moment jedoch, in dem Informationen digitalisiert werden, ändern sich die Eigenschaften der Information. Man kann etwa viel mehr davon erheben, Stichwort Sensorik. Informationen werden ubiquitär und verändern sich dabei gleichzeitig. Außerdem sind sofort und überall verfügbar, nicht mehr archivgebunden oder langsam per Brief zu versenden und von vielen gleichzeitig nutzbar.
Diese so banal klingenden Veränderungen führen zu ganz neuen Möglichkeiten. Zum Ersten erlauben sie neuen Formen der Auswertung und Vorhersage, Stichwort Data Analytics. Zum Zweiten – und noch wichtiger – ermöglichen sie die digitale Automatisierung menschlicher Entscheidungen und Tätigkeiten. Auch KI ist im Prinzip nichts anderes als die Kombination aus neuer Vorhersagefähigkeit und Automatisierung. Selbst bei Sprachmodellen analysiere ich Daten, mache Vorhersagen und automatisiere diesen Prozess.
Die Ökonomen haben in den letzten 15 Jahren erforscht, was in der Wirtschaft passiert ist und was sich durch diese neuen Möglichkeiten verändert hat. Darauf aufbauend haben wir bestimmte universelle Phänomene herausgearbeitet. Wir nennen sie digitale Dynamiken. Sie treten immer dann auf, wenn analoge Informationen in digitale umgewandelt werden und mit diesen gearbeitet wird.
Ein Beispiel ist die Musikindustrie. Musik war früher physisch: Schallplatten, CDs. In dem Moment, in dem diese digitalisiert wurden – MP3, MP4, etc. – änderte sich das Fundament des gesamten Wirtschaftsmodells. In der Folge veränderte sich die gesamte Branche angetrieben durch die digitale Dynamiken wie etwa die Auswirkungen minimaler Grenzkosten. Die digitalen Dynamiken wirken dabei als disruptive Kräfte und haben nach und nach die Akteure, deren Zusammenspiel und die Machtverhältnisse komplett gewandelt.
Wenn wir die aktuelle Marktkapitalisierung der Big Tech-Firmen betrachten, sehen wir eine dramatische Verschiebung der Machtverhältnisse und der wirtschaftlichen Struktu-ren. Wodurch entstehen diese enormen Unterschiede zwischen den Hyper Scaler vor-nehmlich in USA und IT-Unternehmen in Europa?
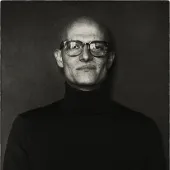
Das Hauptproblem sind die anfänglich sehr hohen Investitionskosten für die digitale Transformation. Sie steigen stetig, so dass kapitalintensive Akteure bevorzugt werden, weil sie die Investitionen stemmen und viel schneller investieren können. Somit haben sie einen First-Mover-Advantage – auch eine typische digitale Dynamik. Dann kann sich eine weitere Dynamik entfalten: Wenn das digitale Produkt einmal da ist, sind die Grenzkosten nahezu null. Die Produktion einer weiteren Einheit – also zusätzliche Rechenleistung oder Speicher – kostet fast nichts. Das macht es extrem preiswert, das Produkt zu skalieren. Das führt zu einer „Winner-takes-most“-Dynamik, wie es die Ökonomen nennen. Oft verstärken Netzwerkeffekte diese Entwicklung noch.
Ähnliche Entwicklungen könnten auch im staatlichen Kontext passieren. Die Kommunen sind finanziell schlecht ausgestattet, die Länder etwas besser, aber der Bund ist derjenige, der große skalierbare Projekte wie etwa die Cloud stemmen kann. Wenn der Bund eine große Cloud aufsetzt, kann er sie skalieren, kostengünstig erweitern und allen anderen anbieten. Am Ende könnte es nur noch eine große Cloud für alle staatlichen Akteure unter Kontrolle des Bundes geben. Das wäre eine typische Folge der digitalen Dynamiken. Es braucht konkreten politischen Willen und Anstrengung um diese zu brechen.
Im staatlichen Bereich werden sehr viele Daten erzeugt und verarbeitet. Wir können un-ser komplexes Staatswesen ohne Digitalisierung kaum mehr steuern. Hilft Digitalisie-rung nicht auch dabei, politische Vorhaben schneller und wirksamer umzusetzen? Könnte man nicht auch sagen, dass Digitalisierung ein Enabler für die Demokratie ist, weil wir dadurch bessere, evidenzbasierte Entscheidungen treffen können?
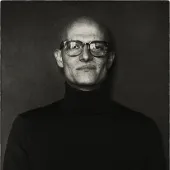
Das würde ich sofort unterschreiben. Was Sie andeuten, ist die Frage der Demokratieakzeptanz. Wenn sich Gesellschaft und Wirtschaft immer stärker digital transformieren, mit digitalen Daten arbeiten und automatisieren – also, wenn sich alles Nicht-Staatliche digitalisiert –, dann stellt sich die Frage: Wie soll ein Staat noch vernünftig regulatorisch steuern, wenn er analog bleibt?
Ja, der Staat muss sich digitalisieren – aber die Frage des „Wie“ wird aus meiner Sicht zu sehr in den Hintergrund gedrängt. Eine der ganz großen Errungenschaften der Demokratie ist, dass sie Machtansammlungen verhindert – dass Macht und Einfluss auf viele Schultern verteilt wird, die sich durch Checks and Balances gegenseitig kontrollieren. Es ist in funktionierenden Demokratien sehr schwer, Macht auf eine Person oder Institution zu konzentrieren – und genau das sollte auch im Digitalen erhalten bleiben.
Ich merke aber, dass die digitalen Dynamiken „auf natürliche Weise“ genau dagegen arbeiten. Deshalb lege ich so starken Fokus auf das „Wie“.
Gleichzeitig erleben wir eine Phase demografischen Wandels mit einer alternden Bevölkerung sowie Teile der Bevölkerung, die mit digitalen Tools nichts anfangen können oder sie ablehnen. Wenn wir „digital only“ machen, verlieren wir diese Menschen – und das betrifft auch wieder die Frage der Demokratieakzeptanz. Der Staat muss also irgendwie beides gleichzeitig leisten. Das bindet nicht nur enorme Ressourcen, sondern macht es auch schwer, Prozesse im Digitalen gänzlich neu zu denken. Das Analoge muss zumindest in einem Mindestmaß erhalten bleiben, kann aber gleichzeitig nicht in der heutigen Form aufrechterhalten werden, weil es zu teuer und oft nicht digitalkompatibel ist. Eine wirklich große Herausforderung!
Beim Vergleich der Verwaltungsdigitalisierung in Europa wird oft Dänemark als positives Beispiel herangezogen, u.a. weil dort „Digital Only“ hohe Akzeptanz findet. Als möglicher Grund wird das hohe Vertrauen der Bürger in ihren Staat angeführt. Vielleicht haben wir ja ein typisch deutsches Problem – dass wir sehr kritisch mit unserem Staat umgehen?
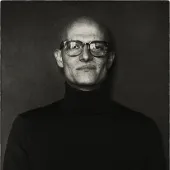
Ja und da habe ich den direkten Vergleich. Ich sehe das jeden Tag in der Schweiz, wo das Vertrauen in staatliche Institutionen sehr viel höher ist. Das liegt auch daran, dass sie besser funktionieren. Denn die Probleme liegen oft schon im analogen Prozess. Und nur weil etwas digitalisiert wird, wird es nicht automatisch besser.
Wenn die Prozesse im Analogen schlecht sind, werden sie durch Digitalisierung meist nicht besser. Und das Vertrauen des Bürgers in den Staat – und damit auch die Akzeptanz – hängt stark daran, ob die analogen Prozesse funktionieren.
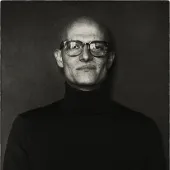
Genau. Und dann entsteht die Gefahr, dass man sagt: „Ich habe es auf kommunaler Ebene nie richtig hinbekommen. Jetzt kommt auch noch die Digitalisierung und ich habe kein Personal – also gebe ich die Aufgabe doch einfach an den Bund – soll der es richten.“ Dahinter steht die Hoffnung, dass auf einer föderal höheren Ebene, eine digitale Lösung gefunden wird, mit der alle Probleme beseitigt sind. Selbst wenn das funktionieren sollte, entstehen aus meiner Sicht dann neue Probleme: Immer mehr Aufgaben könnten zentralisiert vom Bund wahrgenommen werden. Der Föderalismus würde dadurch im Zuge der digitalen Transformation schleichend ausgehöhlt – und das ist nicht unbedingt wünschenswert.
Das führt uns zu der Frage, wie wir die Infrastruktur gestalten sollten. Zentral gesteuerte Systeme können große Effizienzgewinne bringen, gerade in der heutigen Welt, in der rie-sige Datenmengen entstehen und schneller Handlungsbedarf besteht. Was spricht ge-gen so eine zentrale Infrastruktur?
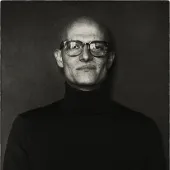
In Deutschland gibt es rund 11.000 Kommunen. Wenn jede einzelne ihre eigene digitale Lösung entwickelt, wäre das selbst bei vorhandenen Standards und Interoperabilität ineffizient und viel zu teuer – keine Frage.
Das eine Extrem wäre also: Enorme dezentrale Vielfalt, weil jede Kommune ihr eigenes Ding macht und entsprechende Reibungskosten. Das andere Extrem: Eine zentrale Lösung, die von Skaleneffekten profitiert, aber andere Probleme schafft: Nicht nur wird der Föderalismus ausgehebelt und es kommt zu erheblichen Machtkonzentrationen, auch fehlt ohne Konkurrenz und Verkaufsdruck der Anreiz ein wirklich gutes Produkt zu entwickeln. Beides halte ich daher für ungeeignet. Ich bin vom Mittelweg überzeugt. Es könnten bspw. drei verschiedene Softwarelösungen für eine konkrete kommunale Dienstleistung zur Verfügung stehen: eine, die auf Bundesebene entwickelt wird, eine, bei der sich mehrere Länder zusammenschließen und eine, bei der sich ein paar Kommunen zusammenschließen. Diese müsste freilich interoperabel sein. Die daraus resultierende Konkurrenz erhöht den Druck eine gute Lösung zu entwickeln und verhindert gleichzeitig Machtkonzentration an einem Ort.
Angesichts dieser Herausforderung wird derzeit viel über Marktplätze diskutiert. Man will Plattformen schaffen, auf denen auch private Anbieter ihre Produkte zur Verfügung stel-len können. Gibt es in Ihrer Studie Vergleiche mit anderen Ländern? Und funktionieren solche Marktplätze tatsächlich?
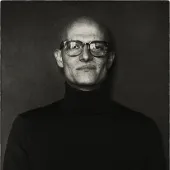
In Estland hat man das Vergaberecht komplett zentralisiert und – auch zur Korruptionsprävention – extrem transparent gestaltet. Dafür wurde eine Plattform gebaut, die alle Vorgänge veranschaulicht - jedes Angebot, jeden Biet-Prozess, jeden Zuschlag. Es ist sehr transparent – nach unserer Einschätzung fast schon zu transparent. Aber sie haben alles einheitlich geregelt. Estland ist ein kleines, zentralistisch organisiertes Land, da ist das viel einfacher.
Ein weiteres Beispiel für starke Zentralisierung ist der Digital Marketplace UK. Es gibt zwar immer noch einzelne Projekte, die am Marketplace vorbeilaufen, aber ein Großteil der Beschaffung läuft über diesen zentralen Digital Marketplace. Es sind über 10.000 Anbieter gelistet, die dort ihre Angebote einstellen.
Prinzipiell finde ich die Idee eines Marketplace gut, aber auch da: Anstatt eines zentralen Marktplatzes, würde ich zwei oder drei Marktplätze bevorzugen. Denn solche Marktplätze – das sieht man in der Privatwirtschaft etwa an Amazon – werden zu extrem mächtigen Gatekeepern. Sie können bestimmte Anbieter hervorheben, andere weniger sichtbar machen, z. B. durch Suchalgorithmen oder Filter. Sobald Tausende Anbieter gelistet werden, fordern die Nuteznden sofort Struktur, um nicht überfordert zu sein: Filter, Empfehlungen, Rankings.
Ein interessanter Effekt ist in England zu beobachten: Der Marketplace dort hat zwar anfangs kleinen und mittleren Unternehmen einen guten Zugang verschafft. Aber über die Jahre ist der Marktanteil der großen Tech-Konzerne deutlich gestiegen. Das ist genau die erwähnte Grenzkostenlogik: Wer einmal investiert hat, hat einen Wettbewerbsvorteil – und dadurch beschleunigt sich die Marktkonzentration und kann letztlich zu Monopolisierung führen.
Im demokratischen Kontext ist das ein besonders schwieriges Spannungsfeld - auf der einen Seite wollen wir Bequemlichkeit und Convenience, denn das wünschen sich die Nutzenden, weil sie es von den privatwirtschaftlichen Angeboten so gewohnt sind. Auf der anderen Seite dürfen dadurch nicht unsere demokratischen Strukturen und die Machtverteilung gefährdet werden. Denn es besteht ein fundamentaler Unterschied: In der Wirtschaft kann ich als Nutzer jederzeit wechseln, ein Produkt abwählen oder ignorieren, wenn sich Fehlentwicklungen zeigen. Im staatlichen Kontext geht das gerade nicht. Der Staat hat zudem das Gewaltmonopol inne. Das macht das Ganze viel sensibler. Wir müssen also einen Mittelweg finden.
"Das Streben nach Effizienz und Nutzerfreundlichkeit darf nicht dazu führen, dass demokratische Strukturen, wie die Gewaltenteilung aus dem Gleichgewicht geraten oder die staatliche Souveränität beeinträchtig wird."
Dr. Christian R. Ulbrich
Wie wirkt sich dieses Spannungsfeld auf die Effizienz im staatlichen Kontext aus?
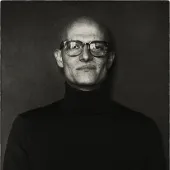
Nehmen wir eine Verwaltungsdienstleistung - sie wird von Sachbearbeitern und Sachbearbeiterinnen erbracht. Diese sind weisungsgebunden, verbeamtet oder angestellt, haben aber meist Ermessensspielräume. Ihre Entscheidungen sind somit dezentral, wenn auch in gewissem Maße kontrollierbar.
Wenn diese Dienstleistung vollständig automatisiert wird, wird sie möglicherweise effizienter im Sinne von kostengünstiger. Aber es entsteht sofort auch ein Zentralisierungseffekt. Jeder Sachverhalt wird nun vorab zentral entschieden und gesteuert, nämlich durch die automatisierende Software sowie durch diejenigen, die sie entwickeln. Damit steigen die Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten für einen kleinen Kreis von Menschen.
Dann stellt sich als nächstes die Frage: Wer setzt denn diese Automatisierung faktisch um? Wer entscheidet, was machbar ist und was nicht und vor allem wie?
Eine Möglichkeit ist, dass der Staat eigene IT-Anbieter oder Inhouse-Strukturen nutzt. Aber dafür fehlen oft Ressourcen und Kompetenzen oder das Ergebnis ist aufgrund der fehlenden Anreize suboptimal. Die andere Möglichkeit ist, dass eines der Big-Tech-Unternehmen beauftragt wird. Dann wandert ein wichtiger Teil der Gestaltungshoheit über den gesamten Prozess plötzlich zu einem privaten Unternehmen im Ausland. Eine dritte Möglichkeit wäre es Unternehmen innerhalb der eigenen Jurisdiktion zu betrauen. Auch hier muss ein komplizierter Mittelweg gefunden werden.
Bei Effizienz und Automatisierung im öffentlichen Sektor muss man sich immer bewusst machen, dass dabei sehr viele andere Dinge gleichzeitig passieren – besonders im Hinblick auf staatliche Kontrolle und demokratische Legitimation. Denn die Digitalisierung greift tief in die Strukturen unseres demokratischen Systems ein und verändert die Art und Weise, wie Macht verteilt und ausgeübt wird. Das Streben nach Effizienz und Nutzerfreundlichkeit darf nicht dazu führen, dass demokratische Strukturen, wie die Gewaltenteilung aus dem Gleichgewicht geraten oder die staatliche Souveränität beeinträchtig wird.
Im zweiten Teil des Interviews mit Christian R. Ulbrich widmen wir uns der Gewaltenteilung: Wie wirkt sich die digitale Transformation auf Parlament und Gesetzgebung aus? Und welche neuen Herausforderungen entstehen, wenn Datenanalyse und Automatisierung zunehmend politische Entscheidungen beeinflussen?
Im Interview
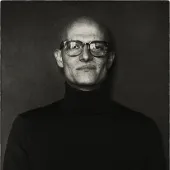
Dr. Christian Ulbrich
Christian R. Ulbrich ist Leiter und Mitbegründer der Forschungsstelle für Digitalisierung in Staat und Verwaltung (e-PIAF) an der Universität Basel, wo er das Forschungsprojekt zum digitalen Staat initiierte und bis heute betreut. Zuvor arbeitete er zu den disruptiven Folgen digitaler Steuerbehörden in einem der global führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen. Er beschäftigt sich seit mehr als zehn Jahren intensiv mit der digitalen Transformation von Staat, Gesellschaft und Unternehmen.
Ihr Ansprechpartner

Werner Achtert
Werner Achtert ist Executive Business Consultant bei msg Public Sector. Seine inhaltlichen Schwerpunkte sind die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung sowie Methoden zu deren Innovation, zum Beispiel Design Thinking und agiles Management. Im Themenfeld KI setzt er sich neben den technischen Möglichkeiten mit den rechtlichen und gesellschaftspolitischen Auswirkungen auseinander. Als ehrenamtliches Mitglied im Vorstand des NEGZ und Sprecher des Arbeitskreises Cloud engagiert er sich im digitalpolitischen Diskurs zwischen Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft.