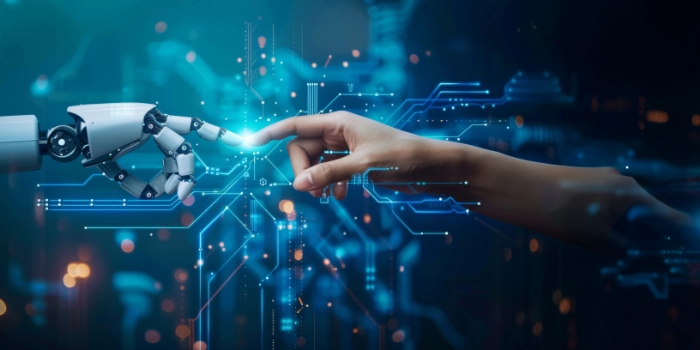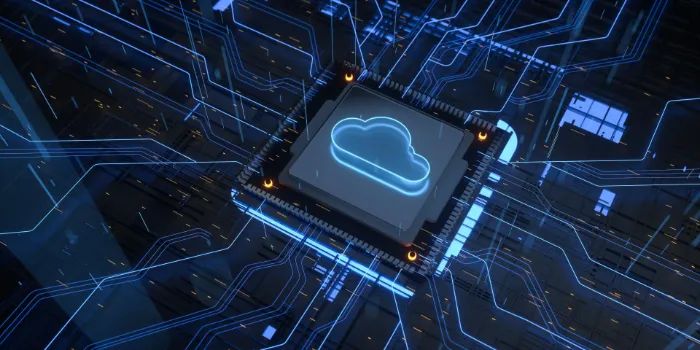Resilienz als Ziel
für Digitalisierung und Staatsmodernisierung
Impuls von Werner Achtert zur Digitalstrategie der Bundesregierung
Am 29. September 2025 hielt unser Kollege Werner Achtert, Executive Business Consultant bei msg Public Sector, im Rahmen der gemeinsamen Sitzung der Bundesarbeitsgruppe Staatsmodernisierung und der Bundesfachkommission Digitale Transformation des Wirtschaftsrates Deutschland e. V. in Berlin einen Vortrag zur Digitalstrategie der Bundesregierung.
Darin stellte er die Resilienz unseres Gemeinwesens als zentrales Ziel für Digitalisierung und Staatsmodernisierung in den Mittelpunkt und zeigte auf, dass Resilienz mehrere Dimensionen umfasst: eine robuste digitale Infrastruktur, wirtschaftliche Stabilität sowie eine handlungsfähige und flexible Verwaltung. Er legte dar, dass Digitalisierung nicht nur Risiken und Abhängigkeiten schafft, sondern dass sie – richtig gestaltet – auch der entscheidende Hebel sein kann, um Staat und Gesellschaft widerstandsfähiger gegen Krisen und Unsicherheiten zu machen.
Im Folgenden stellen wir Ihnen die vollständige Keynote zur Verfügung:
Resilienz als Ziel für Digitalisierung und Staatmodernisierung
Zu Beginn einer neuen Legislaturperiode wird regelmäßig der Ruf nach einer Digitalstrategie laut, so auch beim Start der jetzigen Bundesregierung und der Errichtung eines Ministeriums speziell für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Der Blick zurück zeigt jedoch, dass Digitalstrategien in der Vergangenheit nur begrenzt erfolgreich waren. Ihre Ausformulierung nimmt viel Zeit in Anspruch, ihr Inhalt ist oft geprägt von Kompromissen, die niemandem weh tun, aber auch niemandem wirklich helfen. Über die mangelhafte Umsetzung und geringe Wirkung der letzten Digitalstrategie ist genügend diskutiert und veröffentlicht worden.
Staatssekretär Dr. Markus Richter hat sich vor kurzem dafür ausgesprochen, statt einer großen Digitalstrategie ein kleines Zielbild zu formulieren[1]. Ich möchte diesen Vorschlag aufgreifen und die Resilienz unseres Gemeinwesens als ein zentrales Ziel für Digitalisierung und Staatsmodernisierung erörtern. Resilienz beschreibt „[...] die Fähigkeit sozialer Gruppen, lokaler Gemeinschaften oder ganzer Länder, Gefahren und Gefahrenfolgen zu widerstehen, zu absorbieren, mit ihnen umzugehen und möglichst rasch grundlegende Strukturen und Prozesse wieder zu aktivieren und zu normalisieren“[2]. Ein resilientes System – sei es technischer, biologischer oder sozialer Natur – ist in der Lage, externen Herausforderungen standzuhalten und geht im Idealfall sogar gestärkt aus einer Krise hervor. Die Finanz- und Wirtschaftskrisen der jüngeren Vergangenheit, der Krieg in der Ukraine, die Veränderungen im transatlantischen Verhältnis und die Auseinandersetzungen im Nahen Osten haben uns bewusst gemacht, dass unser Wohlstand sowie die Stabilität und Planbarkeit unseres Lebens nicht mehr selbstverständlich sind. Dies hat zu einer Verunsicherung in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft geführt und das Gefühl der Verwundbarkeit erzeugt. Der Mythos vom Ende der Geschichte,[3] den Francis Fukuyama angekündigt hat, scheint endgültig widerlegt. Die globale Verflechtung hat zu einer zunehmend geopolitischen Komplexität geführt, deren Wechselwirkungen und Abhängigkeiten uns gerade schmerzhaft bewusst werden.
Die Digitalisierung aller Lebensbereiche ist einerseits Treiber dieser Komplexität und andererseits auch ein Mittel zur Beherrschung dieser komplexen Zusammenhänge. Wir haben durch Digitalisierung eine Vervielfachung der Informationsmöglichkeiten erreicht, gleichzeitig beklagen wir die Überlastung durch Informationen und können immer schwerer deren Wahrheitsgehalt beurteilen. Wie können wir also die Resilienz unseres Gemeinwesens in einer digitalen Welt sicherstellen? Wie können wir uns auf Krisen vorbereiten, angemessen darauf reagieren und möglichst gestärkt daraus hervorgehen? Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus der Digitalisierung für die Resilienz unseres Gemeinwesens? Große Teile unseres öffentlichen Lebens, unsere Produktionsprozesse, Kommunikation, Logistik und die komplette Daseinsvorsorge setzen eine funktionierende, in weiten Teilen digitale Infrastruktur voraus. Unsere Stromnetze, die Wasserversorgung, Mobilfunknetze bis hin zu den Stromzählern in unseren Haushalten werden digital gesteuert.
Daher ist erstens die technische Resilienz unserer Infrastruktur eine wesentliche Grundlage unseres Gemeinwesens. Ein eindrucksvolles Beispiel für die Bedeutung digitaler Infrastruktur war der Ausfall des kompletten Abfertigungssystems der Lufthansa aufgrund eines beschädigten Kabels im Jahr 2023[4]. Neben solchen unbeabsichtigten Störungen drohen zunehmend bewusste Angriffe auf kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser, Verwaltungen und Hochschulen. Jüngste Beispiele sind die Sabotageakte auf Kabelschächte entlang von Bahnstrecken und Stromversorgungsanlagen in Berlin sowie der Cyberangriff auf mehrere europäische Flughäfen am 20.09.2025[5].
Wir benötigen zweitens ökonomische Resilienz zur Sicherstellung der materiellen Grundlagen unseres Staates. Nur mit ausreichender Wertschöpfung besteht genügend Spielraum zur Gestaltung unseres Gemeinwesens, zur Verwirklichung unseres gesellschaftlichen Wertesystems, zur nachhaltigen Leistungsfähigkeit unseres Sozialstaates und letztlich zur Stabilität unserer Demokratie. Wir erleben aktuell eine sehr lebhafte Diskussion darüber, welche Leistungen sich unser Staat leisten kann.
Wirtschaftliche Stabilität ist in einer Welt mit globalen Lieferketten und Abhängigkeiten eine große Herausforderung, weil eine Vielzahl von Faktoren wie die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Vorprodukten, Logistikketten[6] und digitalen Steuerungssystemen[7] außerhalb des eigenen Einflussbereichs liegt. Die ökonomische Resilienz hängt in hohem Maße von verlässlichen internationalen Handelsbeziehungen ab, die im Moment massiv infrage gestellt werden.
Für die ökonomische Resilienz des Staates ist daher die Resilienz von Unternehmen, die zur Wertschöpfung beitragen, von großer Bedeutung. Zur Sicherstellung der digitalen Resilienz von Unternehmen gibt es einschlägige Normen[8], für einzelne Branchen sogar standardisierte Vorgaben wie Versicherungsaufsichtliche Anforderungen an die IT (VAIT) im Versicherungswesen. Die eigene ökonomische Resilienz liegt im Interesse jedes Unternehmens, verursacht jedoch auch erhebliche Kosten. Unternehmen werden daher die Investitionen in Resilienz an einzelwirtschaftlichen Überlegungen ausrichten. Die ökonomische Resilienz einer ganzen Volkswirtschaft kann aber nicht nur auf einzelwirtschaftlichen Entscheidungen beruhen. Hier muss der Staat eingreifen - zur Wahrung übergeordneter Interessen, etwa der Versorgungssicherheit mit kritischen Produkten wie Medikamenten.
Zur ökonomischen Resilienz einer Volkswirtschaft gehört auch die langfristige wirtschaftliche Handlungsfähigkeit des Staates. Wenn der Staat zu viel Geld für konsumtive Zwecke ausgibt und dies auch noch mit Schulden finanziert, ist diese Handlungsfähigkeit in Gefahr, da die politischen Spielräume durch zukünftige Zinslasten immer mehr eingeschränkt werden. Wohin das führt, lässt sich in Frankreich aktuell sehr deutlich beobachten. Im digitalen Raum sind wir massiv abhängig von Technologie-Unternehmen aus den USA, deren Entscheidungen wir kaum beeinflussen können. Hier müssen wir dringend europäische digitale Gegengewichte schaffen, wenn wir die Chance auf die viel beschworene Souveränität nicht verspielen wollen.
Erlauben Sie mir an dieser Stelle eine Anekdote zur Veränderungsgeschwindigkeit, die ja durchaus ein wichtiger Faktor für Anpassungsfähigkeit und Resilienz ist. Vor einigen Wochen durfte ich an einem Online-Termin zur Vorstellung eines großen, wirklich großen Förderprogramms teilnehmen. Es ging um die Technologieförderung in genau den Bereichen, in denen wir in Europa und Deutschland Nachholbedarf haben und diesen schnell angehen sollten. Die Vorstellung der Technologiebereiche und des finanziellen Rahmens erweckte bei den Vertretern der Wirtschaftsunternehmen große Erwartungen. Als bei der Frage nach dem Zeithorizont deutlich wurde, dass entsprechende Projekte wohl erst Ende 2026 oder Beginn 2027 beginnen, setzte etwas Ernüchterung ein. Zwei Tage später konnte ich mit einem Vertreter eines Startups telefonieren, der auch an der Sitzung teilgenommen hatte. Das Unternehmen plant den Aufbau eines GPU-Clusters in Europa und die Vermarktung dessen Rechenleistung, also durchaus einen Beitrag zur digitalen Souveränität. Was mich an diesem Unternehmen fasziniert hat, war die Timeline: Gründung April 2025 mit 5 Mio Euro Kapital, zweite Finanzierungsrunde im Herbst 2025 mit 50 Mio Euro und geplanter Start des operativen Betriebs im ersten Quartal 2026. Die Firma wird vermutlich die nächste Generation GPUs eingebaut haben, bis die staatlichen Förderprogramme ihre Ergebnisse vorlegen können.
Wir benötigen drittens eine resiliente Verwaltung zur Sicherstellung der elementaren Aufgaben des Staates wie Gewährleistung von Rechtsstaatlichkeit, Daseinsvorsorge und sozialer sowie innerer und äußerer Sicherheit. Die Verwaltung ist zur regulären Aufgabenerfüllung meist mit klaren Zuständigkeiten hierarchisch organisiert. Diese bürokratischen Strukturen sind für einen geregelten Verwaltungsvollzug sicher sinnvoll und geeignet. In Krisensituationen können diese festen Strukturen eher hinderlich sein, weil sie der selbstständigen, flexiblen Reaktion auf veränderte Bedingungen enge Grenzen setzen. Staatliche Organe müssen auch in Krisensituationen handlungsfähig bleiben, sich flexibel an veränderte Bedingungen anpassen und – im Idealfall – aus vergangenen Krisen lernen. Das traditionelle bürokratische Modell muss weiterentwickelt werden für staatliches Handeln in der viel beschworenen VUCA-Welt – das Akronym steht für „Volatility“, „Uncertainty“, „Complexity“ und „Ambiguity“. Eine digital organisierte Verwaltung hat durch eine verbesserte Datenlage Indikatoren zur frühzeitigen Erkennung von Ausnahmesituationen und damit eine bessere Grundlage für Entscheidungen. Die Unterstützung durch künstliche Intelligenz kann die Verwaltung zudem von Routineprozessen entlasten und Freiräume für mehr Flexibilität schaffen[9][10]. Staatsmodernisierung sollte genau hier ansetzen, um mehr Flexibilität und Effizienz zu erreichen.
Die gesellschaftliche Resilienz eines demokratischen Gemeinwesens basiert auf den genannten Faktoren Infrastruktur, Ökonomie sowie Verwaltung und manifestiert sich in der Widerstandsfähigkeit seiner Prozesse und Institutionen. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist das Vertrauen in staatliche Entscheidungsprozesse und darauf basierend die breite Akzeptanz staatlicher Entscheidungen. In einer repräsentativen und deliberativen Demokratie dürfen Entscheidungen nicht allein durch Mehrheitsfindung und manchmal zufälligen Konsens getroffen werden[11], sondern erfordern einen sachlichen Diskurs. Dazu gehört ein Ausgleich der vielfältigen Interessen und Meinungen unserer pluralistischen, offenen Gesellschaft. Der Soziologe Andreas Reckwitz charakterisiert diese Vielfalt als „Gesellschaft der Singularitäten“[12]. Diese Interessen und Meinungen werden in der digitalen Welt unterschiedlich laut vorgetragen und können zu Verzerrungen der öffentlichen Wahrnehmung führen, wenn diejenigen, die am besten mit digitalen Medien umgehen können, sich am lautesten artikulieren und damit die Richtung der politischen Diskussion bestimmen. Leider sind oftmals für die öffentliche Wahrnehmung Lautstärke und Reichweite wichtiger als Inhalt. In einem demokratischen System sollten Entscheidungen nicht nur auf Basis parteipolitischer Standpunkte und ideologischer Prämissen getroffen werden, sondern sachangemessen erfolgen, unter Berücksichtigung gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse. Gerade bei der Bewältigung von Krisen sind oftmals schwerwiegende Entscheidungen zu treffen, deren Auswirkungen objektiv und evidenzbasiert betrachtet werden müssen. In der digitalen Welt stehen für viele Probleme ausreichend Daten zur Verfügung, wenn auch nicht immer in der erwarteten Geschwindigkeit und Qualität. In der digitalen Welt üben Medien aber auch hohen Druck auf Entscheidungsträger auf, der eine angemessene Befassung mit wissenschaftlichen Fakten erschwert. Zudem wird die wissenschaftliche Diskussion oft in den Medien geführt, statt in den zuständigen Gremien. So besteht die Gefahr, dass bei hohem medialem Druck keine sachgerechten Entscheidungen getroffen werden. Jeder Diskurs in der Demokratie basiert auf der Möglichkeit, sich frei zu informieren und seine Meinung frei zu sagen. In der digitalen, global vernetzten Welt haben Nachrichten eine noch größere Reichweite und verbreiten sich schneller. Das gilt auch für Hetze, Beleidigungen und bewusste Fehlinformationen zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Für den Rezipienten ist der Autor einer Botschaft schwerer auszumachen und damit die Qualität des Inhalts schwerer einzuschätzen.
Eine Erhöhung der Regelungsdichte durch neue Gesetze ist bei Politikern beliebt, weil sie damit Initiative zeigen können. Aber brauchen wir zur Verbesserung der gesellschaftlichen Resilienz neue Regulierungen für den digitalen Raum oder lediglich die konsequente Anwendung der bereits bestehenden Regelwerke[13][14]?
Wir sollten die Prinzipien unseres Rechtssystems nicht ad hoc an veränderten Technologien ausrichten. Angesichts der Geschwindigkeit technischer Entwicklung im Vergleich zu politischen Prozessen können wir diesen Wettlauf nur verlieren. Eine resiliente Gesellschaft muss sich an langfristig gültigen Prinzipien ausrichten, um nicht in politischen Aktionismus zu verfallen. Eine resiliente Gesellschaft muss mit Krisen umgehen, ohne auseinanderzubrechen und ohne ihre demokratischen Prinzipien aufzugeben. Die Themen Corona und Migration verdeutlichen uns die Gefahr einer Spaltung der Gesellschaft. Hier ist digitale Kompetenz entscheidend, um den verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien zu erlernen[15]. Wir brauchen digitale Diskursräume, in denen Bürgerinnen und Bürger gehört werden und sich wahrgenommen fühlen. Gerade in einer digitalen Welt benötigt ein resilientes Gemeinwesen neben Infrastruktur und wirtschaftlicher Wertschöpfung eine handlungsfähige Verwaltung sowie gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dazu gehört eine politische Kultur, in der offener Meinungsaustausch möglich ist und demokratische Entscheidungen akzeptiert werden. Die negativen Exzesse der Polarisierung einer Gesellschaft erleben wir gerade durch das Attentat auf Charlie Kirk und die daraus resultierenden, teils sehr hässlichen Diskussionen. Mit digitalen Technologien können wir uns verbinden, Informationen und Meinungen austauschen und Menschen aus unterschiedlichen Teilen unserer Gesellschaft einbinden. Auch wenn dieser Meinungsaustausch manchmal etwas rau abläuft, ist freie Meinungsbildung auch in der digitalen Welt ein hohes Gut, in das der Staat nicht durch – wenn auch gut gemeinte – Demokratieförderungsprogramme eingreifen sollte. Der ehemalige Staatsrat Henning Lühr hat 2019 anlässlich eines Kolloquiums in Bremen die Frage gestellt, ob wir für die digitale Welt eine neue Staatskunst brauchen[16]. Vielleicht müssen wir nicht so weit gehen. Ein resilientes Gemeinwesen braucht einen aufgeklärten Bürger, der sich am Diskurs in der digitalen Welt beteiligt und eigenständig eine Meinung bildet. Ich denke, es reicht aus, wenn wir uns an Kant orientieren, der als ein Prinzip der Aufklärung postuliert hat: Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen![17] Und das muss auch in der digitalen Welt unser Anspruch sein.
Vielen Dank
[1] Thurid Hustedt: Verwaltung und der Umgang mit Krisen und Katastrophen, Handbuch zur Verwaltungsreform, SpringerLink 2019.
[2] Francis Fukuyama: Das Ende der Geschichte, Hoffmann und Campe Verlag 2022.
[3] Spiegel: Bauarbeiten offenbar Ursache von IT-Ausfall bei der Lufthansa, spiegel.de, 15.02.2023 (abgerufen am 08.03.2024).
[4] Hochschule Kempten: Hacker-Angriff auf die Hochschule Kempten, hs-kempten.de, 04.03.2024 (abgerufen am 04.03.2024).
[5] Bundesrechnungshof: Energiewende nicht auf Kurs: Nachsteuern dringend erforderlich, bundesrechnungshof.de, 07.03.2024 (abgerufen am 18.03.2024)
[6] OpenKRITIS: NIS2 Umsetzungsgesetz, openkritis.de (abgerufen am 04.03.2024).
[7] Tagesspiegel Background Digitalisierung & KI, background.tagesspiegel.de (abgerufen am 05.03.2024).
[8] Anabel Schröter: Wie die Angriffe im Roten Meer die Wirtschaft treffen, wiwo.de, 20.12.2023 (abgerufen am 08.03.2024).
[9] Tagesschau: Störungen der Satellitennavigation im Ostseeraum, tagesschau.de, 04.02.2024 (abgerufen am 08.03.2024).
[10] Beuth: Resilienz in Unternehmen & Organisationen, beuth.de (abgerufen am 04.03.2024).
[11] Inforadio rbb: Produktion bei Tesla ruht noch bis Ende nächster Woche, rbb24.de, 06.03.2024 (abgerufen am 08.03.2024).
[12] Florian Theißing: Eine resiliente Gesellschaft braucht eine resiliente Verwaltung, background.tagesspiegel.de, 07.06.2022 (abgerufen am 08.03.2024).
[13] Prognos: Trendreport 2023: Die resiliente Verwaltung, prognos.com, 2023 (abgerufen am 08.03.2024)).
[14] Russ Mitchell: How Amazon put Ukraine‘s ‚government in a box‘ – and saved its economy from Russia, latimes.com, 15.12.2022 (abgerufen am 08.03.2024).
[15] Klaus Dicke: Über die Resilienz der Demokratie, Herder 2023.
[16] Andreas Reckwitz: Die Gesellschaft der Singularitäten, Suhrkamp 2023.
[17] Bundesministerium der Justiz: Regeln gegen Hass im Netz – das Netzwerksdurchsetzungsgesetz (NetzDG), bmj.de (abgerufen am 08.03.2024).
[18] Europäische Kommission: Gesetz über digitale Dienste, commission.europa.eu (abgerufen am 05.03.2024).
[19] Algorithm Watch: Es gibt keine digitalen Grundrechte, algorithmwatch.org (abgerufen am 08.03.2024).
[20] Sönke E. Schulz: Die digitale Dimension der Grundrechte, Nomos Verlag 2015, S. 110.
[21] Lukas Bernhard, Leonie Schulz, Cathleen Berger, Kai Unzicker: Verunsicherte Öffentlichkeit, bertelsmann-stiftung.de, 2024 (abgerufen am 04.03.2024).
[22] Henning Lühr: Brauchen wir eine neue Staatskunst?, KellnerVerlag 2019.
[23] Immanuel Kant: Berlinische Monatsschrift, 1784.
Ihr Ansprechpartner

Werner Achtert ist Executive Business Consultant bei msg Public Sector. Seine inhaltlichen Schwerpunkte sind die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung sowie Methoden zu deren Innovation, zum Beispiel Design Thinking und agiles Management. Im Themenfeld KI setzt er sich neben den technischen Möglichkeiten mit den rechtlichen und gesellschaftspolitischen Auswirkungen auseinander. Als ehrenamtliches Mitglied im Vorstand des NEGZ und Sprecher des Arbeitskreises Cloud engagiert er sich im digitalpolitischen Diskurs zwischen Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft.
Impressionen