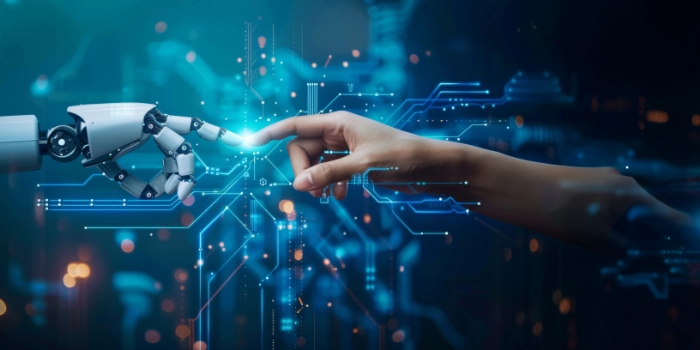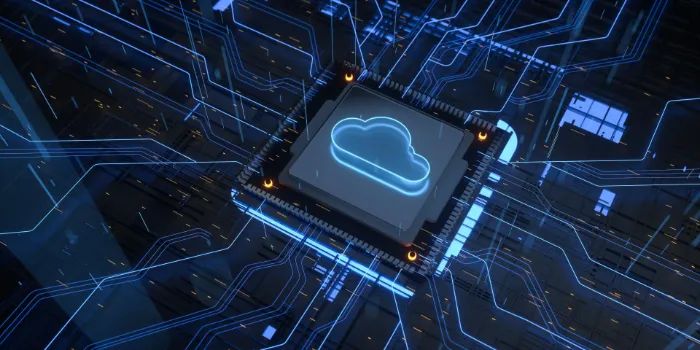Nachbericht zur
MEMO-Tagung 2025
in Münster
Am 2. und 3. Juni 2025 fand an der Universität Münster die MEMO-Tagung unter dem Motto „Einfach machen. Gemeinsam lernen. Digitalisierung meistern“ statt. Die Veranstaltung bot erneut eine spannende Plattform für den Austausch rund um die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung.
Mit inspirierenden Keynotes – darunter von Schirmherr Daniel Sieveke (CIO NRW) – und vielfältigen Fachvorträgen setzte die Tagung wichtige Impulse. Begleitet wurde die Tagung von einer Fachausstellung mit zahlreichen Anwendungsbeispielen und innovativen Lösungen. Der Austausch vor Ort zeigte einmal mehr: Die Digitalisierung der Verwaltung gelingt am besten gemeinsam – mit Offenheit, Mut und praxisnahen Ideen.
Unser Highlight: Der Vortrag „Künstliche Intelligenz für die smarte Stadt – Potenziale synthetischer Daten am Beispiel einer kommunalen Hitzekarte“ von unserem Kollegen Volker Hindermann. Hierbei wurde gezeigt, wie synthetische Daten zur Verbesserung der urbanen Resilienz beitragen können. Den vollständigen Vortrag können Sie im Anschluss nachlesen.
KI-gestützte Hitzekarten in der kommunalen Planung
Ich möchte heute das Thema "Hitze" aufgreifen – ein Aspekt, der zunehmend an Bedeutung gewinnt, insbesondere im urbanen Raum. Unser Produkt, das msg.ThermIQ basiert auf genau diesem Thema. Dabei greifen wir auf verschiedene KI-Methoden und Thesen zurück, die im Folgenden erläutert werden sollen.
Die Grundannahme: Jede künstliche Intelligenz ist nur so gut, wie ihre Trainingsdaten. In der Praxis arbeiten viele KI-Modelle mit historischen, häufig statischen Datensätzen, welche aber selten die Realität im städtischen Raum in Echtzeit abbilden. Genau hier setzen wir mit unserem Produkt an.
Unsere Systeme integrieren Echtzeitdaten, die über Sensoren in der Stadt gesammelt werden – etwa Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind oder Sonneneinstrahlung. Damit wollen wir der Problematik entgegenwirken, dass viele städtebauliche oder verwaltungsbezogene Entscheidungen auf veralteten Daten oder Annahmen beruhen. Unser Ziel: eine datenbasierte, aktuelle Entscheidungsgrundlage für Maßnahmen im Rahmen der kommunalen Hitzevorsorge zu schaffen.
Anfangs stellt sich die Frage: Ist Hitzeschutz in Ihrer Kommune bereits ein Thema und haben wir uns schon mit Hitzeaktionsplänen, Hitzeflächen oder sogenannten Hitzeinseln beschäftigt?
In Osnabrück, meiner Heimatstadt, wurden z. B. bereits Plätze entsiegelt und neugestaltet. Dabei zeigte sich: durch den Einsatz heller Materialien und das Pflanzen von Bäumen konnte die Aufheizung im Sommer um bis zu 2,5 Grad reduziert werden. Solche Maßnahmen zahlen unmittelbar auf den Bevölkerungs- und Gesundheitsschutz ein.
Auch auf Landes- und Bundesebene gibt es Bestrebungen – etwa Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums – entsprechende Hitzeschutzpläne auf kommunaler Ebene zu entwickeln. Städte wie Osnabrück stellen kostenlos Trinkwasserspender auf, um die Bevölkerung an Hitzetagen zu unterstützen. Solche Maßnahmen werden künftig wichtiger – angesichts zunehmender Wetterextreme wie Hitzewellen, Dürren und Starkregen.
Viele Städte stehen vor der Herausforderung, Maßnahmen gegen Hitze, ohne eine belastbare Datengrundlage zu planen. Die klassischen Wetterkarten, die wir aus den Medien kennen, arbeiten oft mit symbolischen Farbcodes – je röter, desto heißer. Aber sie sind zu grob für konkrete Maßnahmen auf Quartiersebene.
Deshalb setzen wir auf ein System, das lokale Echtzeitdaten mit hochauflösenden Luftbildern und Oberflächenklassifikationen verknüpft. In Kombination mit KI-Modellen ergibt sich ein kleinräumiges, präzises Lagebild, auf dessen Grundlage Prognosen, Warnsysteme und gezielte Hitzeschutzmaßnahmen möglich sind.
Wenn bereits Sensorik vorhanden ist, binden wir diese ein. Falls nicht, installieren wir gemeinsam mit Partnern neue Sensoren – etwa in Parks, auf Schulhöfen, an Pflegeeinrichtungen oder auf Großparkplätzen. Diese Punkte dienen dann als Referenz für die Hochrechnung auf vergleichbare Orte. So entsteht aus punktuellen Messwerten ein synthetischer Datensatz, der die Grundlage für stadtweite Hitzekarten bildet.
Vielleicht ein einfaches Beispiel: Wenn wir an einem Parkplatz mit bestimmten Eigenschaften (Größe, Baumabstand, Material) eine Temperatur messen, können wir mit hoher Wahrscheinlichkeit auf andere vergleichbare Parkplätze hochrechnen. Natürlich bleibt dabei eine gewisse Unsicherheit – aber mit zunehmender Sensorabdeckung wird die Prognosequalität immer besser.
Unser Modell nutzt das Prinzip der Data Augmentation, also der synthetischen Erweiterung von Datensätzen. Die KI wird mit diesen Daten trainiert, um Hitzemuster zu erkennen, zu prognostizieren und darzustellen.
Die Darstellung erfolgt über eine browserbasierte Anwendung – ohne GIS-Voraussetzungen. Das System lässt sich aber auch in bestehende Verwaltungs- oder Bürgerinformationssysteme integrieren. Ziel ist eine leichte Einstiegshürde, um auch kleineren Gemeinden Zugang zu einer leistungsfähigen, datenbasierten Lösung zu ermöglichen.
Mit dem msg.HitzeRadar lassen sich:
- Hitze-Hotspots erkennen und visualisieren
- konkrete Maßnahmen wie Trinkwasserstationen, Schatteninseln oder Materialeinsätze planen
- vulnerable Gruppen besser schützen (z. B. in Pflegeheimen)
- städtebauliche Planungen anpassen (z. B. bei Bauprojekten oder Entsiegelungen)
- Arbeitsschutzmaßnahmen verbessern (z. B. durch Pausenregelungen oder Beschattung)
- Warnsysteme in bestehende Katastrophenschutz-Apps integrieren
Jede Stadt ist anders. Deshalb muss auch jede Lösung individualisiert werden. Unser Ziel ist es, ein flexibles System anzubieten, das sich den Gegebenheiten vor Ort anpasst – sowohl technisch als auch organisatorisch.
Was uns antreibt, ist die Überzeugung, dass Echtzeitdaten der Schlüssel zu einer effektiven städtischen Hitzevorsorge sind. Mit präzisen Lagebildern können Städte proaktiv handeln – und damit nicht nur die Infrastruktur schützen, sondern auch Gesundheit und Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger sichern.
Ihr Ansprechpartner


MEMO-Tagung: „Einfach machen. Gemeinsam lernen. Digitalisierung meistern“

Von Links nach Rechts: Volker Hindermann, Nadine Altinger, Ralf Isenberg, Clara Hünker
Ihr Ansprechpartner

Volker Hindermann
Volker Hindermann ist studierter Wirtschaftsinformatiker mit Spezialisierung auf den Themenkomplex Prozessmanagement. Er verantwortet im Public Sector die Abteilung Prozessmanagement, berät Behörden zu der vollen Bandbreite prozessorientierter Managementdisziplinen und ist Experte verschiedener Modellierungssprachen und -werkzeuge.